Buch: Adenauerplatz
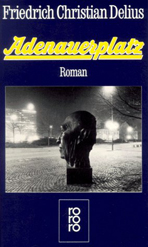 Adenauerplatz
Adenauerplatz
Roman
288 Seiten, HC
€ 13,00 / sFr 23,60
ISBN 978-3-498-01248-9
rororo taschenbuch Werkausgabe
272 Seiten € 9,99 [D]
ISBN 978-3-499-26684-3
Alle Menschen werden Br…
Sie kriegen alles ab, die Schläge, die Aggressionen, den Hass, die Türken fallen am meisten auf, die Zielscheibe, die Stellvertreter, sie sind zahlreich, sie sind wenige, sie sind zu schwach gegen das, was ihnen entgegenschlägt, sie sind zu wenige, wir sind zu wenige, was sind schon viereinhalb Millionen Fremde, wir müssen mehr werden, viel mehr, damit die Deutschen vielleicht einmal verstehen, wie die Welt außerhalb ihrer festen Burg aussieht, nur wir Ausländer können euch Deutschen noch helfen, wir werden euch ein wenig verausländern, aber wir müssen mehr werden, zehn Millionen, dreißig Millionen, sechzig Millionen, warum nicht so viele, wie ihr, wie eure Väter vor vierzig Jahren ums Leben gebracht haben, jeder Asylbewerber soll zwanzig Asylbewerber mitbringen, und wenn das nicht reicht, sollen Einladungen verteilt werden in allen Ecken und Hütten der Welt, und wer will, soll kommen, sie sollen sich aufmachen, die Armen aus den Straßen Kalkuttas, die Landlosen, die Arbeitslosen, die Kranken aus Recife und Santiago und São Paolo, sie sollen, wenn sie noch laufen können, alle kommen, die Frauen und Kinder aus Ghana und Obervolta, die Flüchtenden aus Zaire und Äthiopien und Afghanistan, aus Pakistan und El Salvador, aus allen Erdteilen fallen die Hungerleider millionenstark ein in die reichen Länder, sie besetzen die Flugzeuge und die Schiffe, schieben die Stewardessen und Stewards sachte beiseite und nehmen den Geschäftsleuten und Touristen die gebuchten Plätze weg und schicken sie zurück in die Hotels, sie überrennen die Zöllner und Passbeamten, die nach gültigem Visum fragen, und reißen die Grenzpfähle und Schranken aus, sie überschwemmen die breitwandigen Ankunftshallen und die stillsten Bahnhofsgebäude, voll sind die Landungsbrücken der Häfen mit zerlumpten, dünnen, frierenden Gestalten, kilometerweit die Schlangen, die keine Schlangen mehr sind, die Massen in den Supermärkten, wo sie ihren Anteil zurückholen, wo sie die Regale räumen und die Kassiererinnen auf die Stirn küssen, da sind sie vor den Sozialämtern und Ausländerämtern, in denen die Formulare längst ausgegangen sind und die Beamten an Flucht denken, und wenn die eingereisten Gäste so freundlich sind und überhaupt Anträge stellen, dann beantragen sie politisches Asyl, denn sie wissen besser als jeder Politiker, dass es keine anderen als politische Fluchtgründe gibt, weil sie ihre Armut nicht verschuldet haben, weil sie die Gesetze nicht gemacht haben, weil sie ihre Landesherren und deren Handelspartner nicht gewählt haben, sie sollen alle kommen und ihr Recht auf Leben einklagen, sie sollen kommen, die in Lebensgefahr sind, und über alle Konsulate und Behörden hinwegsteigen und in die USA strömen und nach Spanien und Portugal, sie sollen Frankreich bevölkern und Großbritannien und Skandinavien und die Sowjetunion nicht vergessen, sie sollen, wenn sie wollen, in das Land der deutschen Unschuldslämmer eindringen, die immer noch meinen, an den gegenwärtigen Verbrechen nicht beteiligt zu sein, nur weil sie vor kurzer Zeit selbst die unfasslichsten Verbrechen begangen haben, hierher, in diese Straßen rund um den Adenauerplatz sollen die Fremden kommen mit ihrem ganzen Stolz und alle Wachleute und Polizisten überflüssig machen und nicht nur die Telefonzellen blockieren, sie sollen die Fußgängerzonen verstopfen und die Kaufhäuser einnehmen, den verbotenen Rasen betreten und die Bannmeilen, an den Autobahnen kampieren und vor den Großmarkthallen, sie sollen einmal ihr Recht einklagen, einmal Angst und Schrecken und Einsicht verbreiten allein mit ihrer Anwesenheit, mit einer unübersehbaren Landnahme, sie sollen ihre Welt hereinholen in diese eingebildete erste, Angst und Schrecken und Einsicht, ach!, selbst wenn sie in Massen über die Grenzen strömen, was wird es nützen, die Reichen werden noch perfektere Befestigungsanlagen bauen um ihre Villen und Vorratskeller und Kühlhäuser, jeder bessere Deutsche wird sich bewaffnen, wird jeden Abend den Schäferhund trainieren, Minenfelder und Todeszäune werden das Land durchziehen, und die armen Fremden werden sich auf die halbarmen Deutschen stürzen, Städte und Dörfer werden in Kriegszonen aufgeteilt werden, die Polizei wird mit Wasserwerfern nichts mehr ausrichten, Panzer werden auffahren, ein Mann im Düsenjäger genügt, um den Konvoi mit Schiffen voll Flüchtlingen zu versenken, ein guter Schütze im Cockpit, um ein paar Jumbos abzuschießen, es wird furchtbar werden, wenn die Verdrängten auferstehen, der Aufstand des Südens, die Rache des Nordens, und die große Mehrzahl der Deutschen, der Europäer wird, da kannst du phantasieren wie du willst, die gerechte Teilung, die große Verbrüderung verweigern und weiter die Herzen stereophon mitfühlend schlagen lassen, alle Menschen werden Brüder, ha!
(Seite 205 – 207)
*
Zum Inhalt
„Es schlug neun, als Felipe Gerlach verkleidet war“ – so beginnt die aufregende Geschichte eines modernen Nachtwächters: Ein deutschstämmiger Lateinamerikaner, der im Exil in der Bundesrepublik lebt, Agrarwissenschaftler ohne Anstellung, hat einen Job als Hilfswachmann bei der Wach- und Schließgesellschaft „Secura“ angenommen. Unerschrocken läuft er rund um den Adenauerplatz, das trostlos leere Zentrum einer bundesdeutschen Großstadt, prüft verschlossene Türen der Geschäfte und soll ein Auge auf verdächtige Personen werfen. Während er mit Funksprechgerät und Gummiknüppel durch die Straßen streift, holen seine Gedanken immer wieder die sogenannte Dritte Welt in die Schaufensterwelt der Ersten hinein – eine „große Kontinentalverschiebung“ im Kopf des Felipe Gerlach.
Der Roman folgt dem Wachmann auf seiner vom Revierbuch vorgeschriebenen Route von neun Uhr abends bis vier Uhr morgens. Die Nachricht vom Tod seiner Mutter und der Auftrag, politischen Freunden bei einem Einbruch im Büro eines „Südamerikaverkäufers“ Schmiere zu stehen, bestimmen den Ablauf der Nacht.In den vielfältigen und abwechslungsreich erzählten Neben- und Liebesgeschichten, in Rückblenden und simultanen Überblendungen, Traumszenen und Assoziationsfeldern fächert der Autor diesen nächtlichen Gang zu einem historischen und zeitgenössischen deutschen Panorama auf: Die Familiengeschichte der Gerlachs, die zur Schicht der rechtsradikalen deutschen Kolonialisten in Südamerika gehören, Felipes Jugend in der „heilen deutschen Welt am Rand der Anden“, seine Arbeit für die Landreform, die Erfahrung, von Panzern und Maschinengewehren fast zu Tode gehetzt und verjagt und aufgefangen zu werden im Land seiner Urgroßeltern, abzuwarten im „erträglichen Ausnahmezustand Demokratie“.
Delius unternimmt den Versuch, die beinah tragische Figur eines „Guten“ zu zeichnen, eines moralischen Siegers ohne Einfluß, der zwischen der neudeutschen Jammerei und der neudeutschen Korruption, zwischen der Anhimmelung der Dritten Welt und ihrer Ausplünderung, an der Moral von Wahrheit und Gerechtigkeit festhalten möchte.
Felipe, am Nullpunkt seines Exils angelangt, versucht nach vorn zu blicken: die Chancen der Rückkehr, die Möglichkeiten der Einbürgerung im „ewigen Manövergebiet Deutschland“, die Tragfähigkeit der Liebe zu seiner deutschen Freundin und der kleine Kampf gegen den Südamerika-Spekulanten Ellerbrock werden vom Autor in immer überraschenderen Wendungen durchgespielt. So wird aus dem vielschichtigen, suggestiven Großstadtroman, aus dem Nachtbuch „Adenauerplatz“ – vielleicht die „Nachtwachen des Bonaventura“ unserer Tage – unversehens eine verhaltene Liebesgeschichte und ein diskreter Kriminalroman.
„Adenauerplatz“ ist eine einfühlsame Romanstudie über doppelte Heimatlosigkeit – und zugleich ein Plädoyer für politische Moral, die in einer Zeit verloren zu gehen droht, in der schon die laufenden Katastrophen nicht mehr schrecken.
„Der flotte und gewitzte Formulierer und Moralist Delius legt in seinem zweiten Roman ein allzu dürres Handlungsgerüst vor und kombiniert Figuren und Verhältnisse zu einer lehrhaften Plattheit.“ (Konkret)
„Der Roman ‚Adenauerplatz‘ bietet keinen Lesegenuß. Er läßt unbefriedigt. Er stellt Fragen, ohne Antworten zu wissen. Er ist ein Störfaktor. Aber gerade das sind auch die Gründe, diesen Roman zu lesen.“ (Süddeutsche Zeitung)
„…so möchte ich dieses Buch einmal hören, im Radio vielleicht, nachts, vorgelesen von einem Sprachkünstler, der das Pathos, das Leid also, noch darzustellen weiß – ich bin sicher, jeder der zuhörte, und hätte er in seinem Leben keine drei Bücher gelesen, bliebe zweihundertachtzig Seiten lang gespannt, gerührt, verärgert, zornig, atemlos den Monologen des Nachtwächters Felipe Gerlach lauschend wach bis zum Morgen.“ (Die Zeit)
„Über zweihundertachtzig Seiten kein einziger Gefühlsausbruch, kein Lachen, nicht einmal Lächeln, niemals Weinen. Menschen nirgends, nur Papiergenossen, Thesen, Träume und Reflexionen auf Beinen.“ (Die Welt)
„Eine Kombination von assoziativer Bildhaftigkeit, von Serien subjektiv gefärbter Momentaufnahmen mit brillant pointierten und durchgespielten kritischen Reflexionen, hierin den ‚Nachtwachen‘ des schwarzen Romantikers Bonaventura vergleichbar.“ (Neue Zürcher Zeitung)
„Experimentelle Prosa, ein mutiges Buch. Der Spannungsbogen in Delius‘ Buch ist unerhört und wird gewiß viele Leser einfangen, die das Erzählte in enger Verknüpfung von Intellektuellem und Emotionalem durchmessen. Auf ‚Adenauerplatz‘ trifft zu, was Fritz Rudolf Fries einmal formuliert hat: ‚Solange ein Buch beunruhigt, ist es gut, es kann etwas bewirken‘.“ (Hannoversche Allgemeine Zeitung)
„Das Buch ist ärgerlich schlecht geschrieben, oft auch nur schlicht langweilig.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Leben als Erlaubnis, den Tod kennenzulernen
Über F.C. Delius und die Vielfältigkeit eines ganz einfachen Romans
Friedrich Christian Delius‘ zweiter Roman ‚Adenauerplatz‘ ist ein Nachtbuch über Deutschland und zugleich eine Reise durch die ganze Welt in sieben Stunden. Die Reise findet im Kopf statt, während die Füße immer um den Adenauerplatz und durch die angrenzenden innerstädtischen Straßen einer westdeutschen Provinzgroßstadt laufen. Vielleicht heißt sie Bielefeld oder so ähnlich oder ganz anders. Der da läuft und denkt, heißt Felipe Ramón Gerlach Hernandez; er lebt im Exil und hat als deutschstämmiger Gastarbeiter einen Job als Nachtwächter bekommen. Ausgerüstet mit einer deutschen Uniform, mit Gummiknüppel und Funksprechgerät dient er von abends neun bis vier Uhr morgens im Auftrag der Objektschutzfirma Secura der inneren Sicherheit seines Gastlandes.
‚Ein Held der inneren Sicherheit‘ – das war der Titel von Delius erstem, 1981 erschienenem Roman. Aber Felipe Gonzales hat mit jenem karrierebesessenen, um seine Sicherung kämpfenden Opportunisten Roland Diehl nur wenig zu tun, und ich gestehe, daß ich entschieden lieber mit dem Hilfswachmann Felipe durch die unsichere Nacht laufe als mit Roland Diehl durch die Korridore und Sitzungszimmer der „Menschenführer“. – Erinnern wir uns: Dem „Verband der Menschenführer“ entsprach in der Realität des deutschen Herbstes 1977 die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, deren Präsident Hanns Martin Schleyer entführt worden war. Diehl, der Chefdenker und Ghostwriter des Roman-Präsidenten Büttinger, fürchtet um seine Karriere, aber er entscheidet sich zynisch fürs „Weitermachen“; der Erfolgt gibt ihm recht, und munter strebt er „neuen kriegerischen Zeiten“ entgegen.
‚Ein Held der inneren Sicherheit‘ ist ein politischer Roman, vom politischen Anlaß (der Schleyer-Entführung) zwar weggeschrieben, aber eben doch ein Roman aus gegebenem Anlaß, ein kritischer Gesellschaftsroman überdies, der den Kriegsschauplatz Bundesrepublik im Herbst 1977 aus der Perspektive des schnellen BMW-Fahrers und der Herren der Chefetagen zeigt. Es wäre völlig verfehlt, den Blickwinkel des „Helden“ mit dem des Autors Delius gleichzusetzen, dennoch führte der Gesellschaftsroman ‚von oben‘ zwangsläufig zu Defiziten etwa der Milieuschilderung; Stephan Reinhardt hat in seiner Besprechung des Romans im zweiten Heft von LESEZEICHEN darauf hingewiesen.
Wechsel der Perspektiven
Der neue Roman ‚Adenauerplatz‘ hat solche Schwächen nicht. Felipe, dieser innerlich unsichere Secura-Wachmann, der ein arbeitslos gewordener Agrarwissenschaftler und Erforscher des internationalen Zuckermarktes ist, steht auch seinem Autor offensichtlich näher als der Chefdenker des Arbeitgeberverbandes. Delius ist diesem neuen Helden nicht verfallen, er glaubt ihm nicht jedes Wort (und läßt ihm damit auch ein Stück Freiheit), aber er liebt ihn und läuft gern mit ihm durch die nächtlichen Straßen und die grell erleuchteten Unterführungen des Platzes. ‚Adenauerplatz‘ ist ein Gesellschaftsroman ‚von unten‘, geschrieben aus der Perspektive eines klugen ‚kleinen‘ Mannes.
Überblickt man das Deliussche Prosawerk und auch einen Teil der in vieler Munde und Mäuler geratenen Gedichte (die ‚Moritat auf Helmut Hortens Angst und Ende‘ zum Beispiel aus dem Gedichtband ‚Ein Bankier auf der Flucht‘), so fällt auf, daß diese Perspektive völlig neu ist im Werk des linken, intellektuellen Autors. Links und intellektuell? Ja, gewiß. Der promovierte Literaturwissenschaftler und ehemalige Verlagslektor bei Wagenbach und Rotbuch hat, so könnte man es auch sagen, nicht nur ‚Das Kapital‘ gelesen, sondern immer auch den Wirtschaftsteil der bürgerlichen Zeitungen. Gerade das macht ihn ja so beunruhigend für deutsche Wirtschaftsführer und Gerichte, die sich jahrelang mit ihm auseinandergesetzt und ihn dadurch viel Zeit und Geld gekostet haben.
Die Kunst des Zersetzens
Delius hat in den sechziger Jahren als Lyriker begonnen (‚Kerbholz‘, 1965; ‚Wenn wir, bei Rot‘, 1969). Das waren, verkürzt gesagt, kritisch inventarisierende „Lesarten“ der Wirklichkeit und nachdenkliche „Para-Phrasen“ einer Sprache der Herrschenden. Fast gleichzeitig entwickelte er damals – zunächst gereimte – Großformen entlarvender Faktographie, der selbst „Dokumentar-Polemik“ oder „Dokumentarsatire“ genannt hat. Er übte sich in der Kunst des Zersetzens, indem er das von den Mächtigen glänzend beherrschte „Handwerk des Zersetzens“ bloßlegte. Auch das waren Bücher aus gegebenem Anlaß: ‚Wir Unternehmer‘ (1966) ist eine Montage aus den „ethischen“ Überbau-Passagen der Protokolle des Düsseldorfer CDU/CSU-Wirtschaftstages von 1965. Es ging damals auch um eine Variante der Linnéschen Klassifizierung: Kritische Schriftsteller = Pinscher. ‚Unsere Siemens-Welt‘ (1972), eine fingierte „Festschrift zum 125jährigen Bestehen des Hauses S.“ kann als ein Höhe- und Endpunkt der satirischen Dokumentarliteratur angesehen werden. Der drei Jahre währende Prozeß, der beinahe den Berliner Rotbuch-Verlag vernichtet hätte, endete als Vergleich, der eigentlich einer Niederlage des Klägers Siemens gleichkommt: Die diktierten Einschwärzungen der „Prozeß-Ausgabe“ des Buches sind minimal, aber der Standpunkt des Gerichts, daß auch der Autor einer fingierten Selbstdarstellung erfolgreichen Unternehmertums zitierfähiges Quellenmaterial auf seine Richtigkeit zu prüfen habe, versetzte dieser Art künstlerischer Dokumentarliteratur und inhaltlich vergleichbarer journalistischer Arbeit einen schweren Stoß. Ob der wirklich letal ist, wird sich herausstellen.
Im Lauf der Erinnerung
So gesehen, ist de Roman ‚Adenauerplatz‘ auch eine Antwort auf dieses Urteil. Delius, der lyrische Aufklärer, der besonnene Satiriker und Dokumentarist, hat mit diesem Roman, mehr noch als mit seinem ersten, das Erfinden gelernt, ohne dabei seinen gesellschaftskritischen Wahrheitsanspruch aufgegeben zu haben. Nun wäre das nicht eben viel, hätte sich Delius nicht für die an sich wenig ereignisreiche durchwachte Nacht eine dichterische Struktur ausgedacht, die man peripatetisch nennen könnte: „Das Gehen begann im Gehirn und endete im Gehirn.“ Da befiehlt einer sieben Stunden lang in einer milden Septembernacht seinen Beinen, seinen Ballen, Zehen und Fersen das Laufen, „als sei das Laufen das Leben“, und „mit den Schritten kommt das Erinnern und durchdringt Verkleidung, Haut und Schädeldecke“. Der da läuft, ist ein Kopffüßler; seinen Körper hat er verliehen und unter der Uniform eines Hilfspolizisten verborgen, gegen deren Identifikationsansprüche er sich wehren muß. Schritt für Schritt kämpft er um seine Identität, denkt – seine Runden drehend – Schicht für Schicht seine und unsere Vergangenheit, seine und unsere Gegenwart herbei. Die Stechuhren der bewachten Gebäude laufen, die Zentrale wartet auf seine Alles-okay-Meldungen, und mit Felipe läuft der Tod, dem er nur knapp entronnen ist.
Und er läuft, um „die große Kontinentalverschiebung rückgängig zu machen“, obwohl er weiß, daß ihn drüben, auf dem anderen Kontinent, nur der Tod einholen würde.
Felipe Gerlach Hernandez ist Südamerikaner, Chilene, wie der Name seiner Heimatstadt Osorno verrät. Er ist das schwarze Schaf, der rote Philipp einer noch immer faschistischen, auf ihre deutsche Herkunft eingebildeten Landbesitzerfamilie. Ein Revolutionär im engeren Sinne war er nicht; er hat die Unterdrückung der Besitzlosen nur registriert, Spurensicherung mit der Kamera betrieben, sobald er alt genug war dafür. Dann hat er sich für die Agrarreform eingesetzt, mitgeholfen, auch seiner eigenen Sippe ein Stückchen von ihrem Land zu nehmen – nicht mit der Waffe in der Hand, sondern als legaler Sachbearbeiter im Ministerium. Das reichte für Verfolgung, Verhaftung und schließlich Abschiebung nach Deutschland mit dem Lufthansaflug 505.
Nachtwachen eines Kopffüßlers
Bis in die Träume verfolgen ihn die Mördergesichter und die Schüsse der Gorillas. Die revolutionären Freunde „in einem der freiesten Länder der Welt, im Ausnahmezustand einer erträglichen Demokratie“ können nicht genug davon hören, und sanfte Studentinnen bieten ihm mild ihr Geschlecht an, als wär’s eine warme Mahlzeit der Bahnhofsmission. Doch als die Unistellen in Deutschland knapp werden, als sich Felipe mit seiner Doktorarbeit über den Zuckerhandel verzettelt und die sozial-liberale Koalition zerbricht, werden die informationshungrigen Freunde, „plötzlich ganz knallharte Dritte-Welt-Fanatiker“. Die Fragenden ändern die Tonlage: Warum man denn nicht zurückginge, um zu kämpfen? „Als seien wir alle geborene Guerillakämpfer.“ Felipe flieht wieder, wird Gastarbeiter, kriegt seinen Job als Hilfswachmann, weil er halber Deutscher ins Reformkonzept seines Chefs paßt (schließlich war er in seiner Heimat mal bei der freiwilligen Feuerwehr), überlegt und verwirft den Plan einer Einbürgerung in die Bundesrepublik, wo es den Eingeborenen allmählich nicht viel besser geht als den Fremden. Solche unfreiwilligen Angleichungen stimmen ihn freundlich.
Ein ganzer Katalog neuester Sachlichkeit ist in den Roman eingeschmolzen. Die Vereinsamung und Verwüstung unserer Städte, die Ängste und die Fremdenphobie der Deutschen und andererseits ihr heimlich-heilsames „Verausländern“; der Widerwille gegenüber Alten und Kranken, die „Angst der Achtzehnjährigen vor dem Tod“ als Motiv, den Wehrdienst zu akzeptieren; das schmutzige Geschäft der westdeutschen Anlageberater mit südamerikanischem Weideland, Rinderkauf als sofort abzugsfähige Betriebsausgabe, die Analysen von industrieller Tierhaltung, Rohstoffausbeute, Missionsgeschichte und Zuckermarkt; die Initiationsriten der Zehnjährigen im Fast-Food-Restaurant und schließlich das Nachdenken über die Hoffnungen der Linken und deren vergebliche Bemühungen, sich „mit fünfzig Millionen Verhungerten jedes Jahr“ solidarisch zu fühlen. Ich habe lange keine deutschsprachigen realistischen und politischen Roman gelesen, der so vielschichtig erzählt und scheinbar mühelos so viel Welt in eine ganz einfache, vom Rhythmus der Kontrolluhren bestimmte Handlung hineinholt.
Gewiß, es gibt da auch noch eine Kriminalgeschichte, einen Einbruch aus politischen Motiven, bei dem Felipe Schmiere stehen soll, und es gibt die Geschichtslehrerin Anke, die am Abend die Demonstration gegen den Fahneneid der Rekruten erlebt, die nachts ihren Felipe sucht, weil sie weiß, daß in Chile seine Mutter gestorben ist. Aber das, woraus andere eine Handlung aufbauen würden, bildet hier nur den erzählerischen Rahmen für die Kopferlebnisse dieser peripatetischen Nachtwachen des Felipe Gerlach. Im Morgendämmern kriecht der müde gelaufene Wachtmann zu Anke ins Bett und flüstert „das Abschiedswort: Hier bin ich“. Das ist der Abschied des Tagschläfers, der sein „exotisches“ Exil nur nachts zu ertragen vermag – in der ihm fremdesten aller Verkleidungen, der Uniform; und das ist auch eine Absage an Chile, an die „Rückkehr in die Fremde“. Felipe Gerlach lebt unter reduzierten Bedingungen, „bei niedrigster Körpertemperatur“. Träumend erschließt sich ihm der Sinn des Lebens: „Die Erlaubnis, den Tod kennenzulernen“. F.C. Delius hat aus diesem poetischen Denkspiel um Reduktion und äußerste Erweiterung einen reichen Roman gemacht.
(Herbert Wiesner, Lesezeichen, Heft 9, Frankfurt 1984)
Nächtliche Predigt
Friedrich C. Delius‘ Roman „Adenauerplatz“
„Adenauerplatz“ – ein Titel mit Anspruch. Der promovierte Literaturhistoriker Friedrich Christian Delius wird wissen, welche Assoziationen er damit bei den promovierten Literaturhistorikern unter seinen Lesern weckt. An „Kungsgatan“, an „Washington-Square“ werden einige denken, an „Main Street“ oder „La placa del Diamant“ andere, und alle an „Berlin Alexanderplatz“. Der Name einer Straße, eines Platzes als Titel – das ist Programm, da sehe ich gleich die Menschen, die tagtäglich diesen Platz überqueren, ihre sich kreuzenden Schicksale, ihr Mit- und Gegeneinander beispielhaft dargestellt für das Oben und Unten, das Auf und Ab, für die komplizierte Mechanik einer ganzen Gesellschaft in der Beschränkung auf diesen einen Ort. Einen Gesellschaftsroman also suggeriert der Titel, einen politischen Roman – und das spricht von vornherein, sozusagen vom Umschlag an, für einen Autor, der mit einem solchen Unternehmen die allgemeine Märchenseligkeit des Lesevolkes zu stören wagt, das sich schon seit geraumer Zeit mit einer unendlichen Geschichte, lieben Grüßen und geheimnisvollen Rosen in die Nebel von Avalon zurückzugezogen hat.
Seine Geschichte ist glücklich erfunden. Es ist die Geschichte einer Nacht: Felipe Gerlach, deutsch-südamerikanischer Agrarwissenschaftler, aus seiner Heimat ausgewiesen und in Deutschland, nach einigen Jahren an der Universität ohne Stellung, läuft als Nachwächter um den „Adenauerplatz“, irgendeinen Adenauerplatz irgendeiner deutschen Stadt und läßt Leben und Arbeit in Gedanken Revue passieren.
Ein Verkehrsknotenpunkt ist dieser Adenauerplatz, ein Verknüpfungspunkt auch für den Roman. Im Monolog der Trauer über das Vergangene, die vertanen Chancen, die gescheitere, wieder rückgängig gemachte Landreform in der Heimat (Chile mag hier das nichtgenannte Beispiel sein) und in dem Zorn auf die Öde, die fade Wohlhabenheit der neuen Heimat, wie sie der Adenauerplatz in Marmor und Stahl repräsentiert, verbinden sich die Motivkreise des Romans: das Elend zweier Kontinente. Nebenfiguren tauchen auf: die Freundin Anke, die Felipe liebt, hilflos und ohne Versprechen auf eine Zukunft, und der Schieber Ellerbrock, „Anlageberater“ wie es im Flick-Deutsch wohl heißt, der solventen Kunden für billiges Geld gutes Weideland in Südamerika verhökert. Und Erinnerungen an die Kindheit im fernen Südamerika, an den faschistischen Gerlach-Clan, an jenes Land, das nach einigen Jahren der Hoffnung wieder an die reaktionäre Tyrannei verlorenging.
Im einsamen Rundgang um den Adenauerplatz, um den nächtlich-toten Mittelpunkt der menschenlosen, ausverkauften „City“ wächst alles dies langsam zusammen, erklärt sich Felipe der verborgene Mechanismus, der das Elend dieser Welt im Innersten zusammenhält.
Wie schon in seinem ersten Roman „Ein Held der inneren Sicherheit“ versucht Delius, politisches Schicksal aus privatem Schicksal zu erklären – Biographie als Geschichtsschreibung. Gegen die standardisierten Abwehrfloskeln der Berufspolitiker – das kann man nicht vergleichen; das gehört nicht hierher; das muß man getrennt sehen – setzt Delius seine Zusammenhänge, besteht er auf dem „Zusammen-denken“ von auch scheinbar Fremdartigem als Grundbedingung für politisches Denken überhaupt.
Ob er männliche und weibliche Formen der Gewalt reflektiert, die Initiationsriten der Jugendlichen im McDonald’s-Restaurant beschreibt oder die Unfähigkeit der Linken beklagt, statt ihre Omnipotenzphantasien auf die Befreiungsbewegung der Dritten Welt zu projizieren, lieber vor der eigenen Haustür zu fegen, immer sind diese Überlegungen und Beobachtungen aufeinander bezogen, einander stützend, ergänzend, erklärend, Teil eines großen Zusammenhangs. Und man braucht nicht die Dossiers des Club of Rome oder „Global 2000“ studiert zu haben, ein Blick in die Zeitung am Morgen genügt, um etwas von dem allerdunkelsten Zusammenhang zu wissen, den Delius hier beleuchtet: die Ausplünderung der Dritten Welt durch die erste, die Fortsetzung der Kolonisation mit eleganteren Mitteln, die Sabotage einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung durch eine politische Klasse, die Solidarität nur für den Namen einer polnischen Gewerkschaft hält.
Daß dies die Gedanken eines Nachtwächters sind, eines, der den Schutz und die Sicherheit, also die Unveränderbarkeit des Bestehenden garantieren soll, ist die besondere, absurde Pointe dieses Buchs.
Doch scheint gerade hier auch eine Schwäche des Romans zu liegen, denn ist das alles nicht ein wenig sehr, ein wenig zu exemplarisch? Immer wieder erliegt Delius einem Hang zum Parabolischen, der die Beschreibung, in der Absicht, sie möglichst allgemeingültig erscheinen zu lassen, merkwürdig vergröbert. Da heißt es zum Beispiel angesichts der sich rasch leerenden Innenstadt am Abend: „Die wenigen Menschen, die noch die Kraft aufbrachten, an einem Abend in der Woche ein Vereinslokal, ein Restaurant oder ein Filmtheater der Innenstadt aufzusuchen, der Opernsängerinnen oder den Lautsprechern der Discotheken zuzuhören, die parkten ihre Autos möglichst nah am angesteuerten Ziel.“ „Ein Filmtheater der Innenstadt aufzusuchen“ – gemeint ist wohl: ins Kino zu gehen.
Auch die Personen, Anke und Ellerbrock, ja Felipe selbst, wirken seltsam eindimensional, entwickeln nur eine sehr karge Individualität. Ein Gesellschaftsroman, wie ihn der Titel verspricht, in dem Menschen verschiedenster Klassen, Temperamente, Lebensalter zueinander in Beziehung gebracht werden, wie Figuren auf einem Schachbrett, einander schlagend, schützend, überspringend, die sorgfältige Auslegung eines Handlungs- und Motivgeflechts, die Aufdeckung der Wirklichkeiten hinter den Fassaden, die poetische Nachbildung des Uhrwerks, das sich hinter dieser Welt bewegt, ein Gesellschaftsroman also ist „Adenauerplatz“ nur bedingt. Alles das, was einen solchen Roman ausmacht, kommt bei Delius als Handlungshintergrund vor und macht doch nicht die eigentliche Handlung aus, ist erzählte Wirklichkeit und dringt doch nie bis in die Wirklichkeit der Erzählung vor.
Nein, die unbestreitbare Dynamik des Textes, sein leidenschaftliches Feuer, kommt aus einer anderen Quelle: seiner Rhetorik. Das Übermaß an Rhetorik, die über Seiten hin sich stürzenden Sätze, ausgetüftelt nach allen Regeln dieser schönen Kunst, ist der Tod des Romans und gibt doch gleichzeitig dem Text sein echtes Pathos, seinen großartig-barocken Prunk: „Felipe konnte sie (die Toten) nun in keinem Schaufenster mehr übersehen, in jedem Verkaufsraum schienen sie zu waren auf ihre Käufer, auf ihre Hinterbliebenen. Sogar in den einfachsten Konservendosen zeigten sie sich, hinter deren aufgeklebten bunten Etiketten das nackte, stumpfe Zinn hervortrat, das Zinn Amerikas, mit dem die dreißigjährigen Minenarbeiter auferstanden, die hustend und Blut spuckend und gebückt durch stickige Gänge krochen, mit einer hoffnungslosen Geste noch am Leben hängend, den Gewehrkugeln der streikbrechenden Soldaten entkommen und den Schlagwettern und dem Dynamit der schlampigen Sprengmeister, keuchend traten sie aus den Minen voll tropischer Hitze und eisiger Kälte und wieder Hitze, aus feuchter Luft voll Gas und Kieselstaub, der in den Lungen sich festfraß und sie langsam zerbiß, so traten die Männer ans Licht, Kokablätter mit Asche kauend, die den Hunger milderten und die Müdigkeit angenehm machten und den Geruchssinn, den Geschmackssinn und die Nerven abtöteten, bis kein Schmerz die taumelnden Körper mehr warnen konnte, die sich hinaufschleppten zu den dünnen Hütten in viertausend Meter Höhe, zwischen Müll und Exkrementen zu ihren hungernden Familien, zu ihren getretenen Frauen, und sie tranken noch einmal das Wasser aus rostigen Benzinkanistern und krepierten, wie die Betriebswirte es kalkuliert hatten, mit dreißig Jahren, wie der Markt es befahl…“
Hier sind die Grenzen des Romans, wie ihn die ersten Seiten entworfen haben, längst gesprengt, diesen Zorn faßt er nicht länger, diese Wut: auf die schöne Warenwunderwelt der Adenauerplätze und Einkaufspassagen, auf jenen vor speckiger Saturiertheit glänzenden Spießerhedonismus aus „schön wohnen, lecker essen, viel reisen“, der dumpf und ahnungslos eine Welt zum Teufel gehen läßt.
Hier wird nicht mehr erzählt, hier wir atemlos, mitreißend – gepredigt. Predigt – das klingt abwertend, und es muß daran erinnert werden, was Predigten einmal waren, wie im Mittelalter die Menschen zu Tausenden herbeiströmten, um einen Mann des Wortes zu hören, einen Meister Ekkehard, einen Franz von Assisi, einen Berthold von Regensburg, einen Thomas Münzer. Predigten – das war Literatur, eine große, vitale Literatur, die in das Leben der Gesellschaft eingriff, lange bevor ein Buchstabe gedruckt werden konnte.
Delius‘ Buch, ich wage diese These, steht in dieser Tradition. Es ist eine solche Predigt, die sich der Mittel des Romans bedient. Dies ist die eigentliche Kühnheit des Buches, das macht diese Prosa glanzvoll und schwierig zugleich.
„Liest es sich“ zuweilen auch ein wenig mühsam und wird der Leser, an das fast-food der Fernseh- und Illustriertensprache gewöhnt, bei der Lektüre häufig ermüden, so mächte ich dieses Buch oder Kapitel daraus, wie „LH 505“ oder „Ein paar Tote“, einmal hören, im Radio vielleicht, nachts, vorgelesen von einem Sprachkünstler, der das Pathos, das Leid also, noch darzustellen weiß – ich bin sicher, jeder, der zuhörte, und hätte er in seinem Leben keine drei Bücher gelesen, bliebe zweihundertachtzig Seiten lang gespannt, gerührt, verärgert, zornig, atemlos den Monologen des Nachtwächters Felipe Gerlach lauschend wach bis zum Morgen.
(Benedikt Erenz, Die Zeit, 30.11.1984)
Wo Geld Gesetze und Geschichte macht
F.C. Delius‘ zweiter Roman „Adenauerplatz“
Ein Septemberabend in einer westdeutschen Großstadt. Während Hilfswachmann Leo acht, ausgerüstet mit Revierbuch, Schlüsseltasche, Gummiknüppel und Sprechfunkgerät seinen Kontrollgang gegen neun Uhr abends beginnt, findet zur gleichen Zeit im Stadion der Stadt eine öffentliche Rekrutenvereidigung statt, mit Heeresmusikcorps und feierlicher Ministerrede, aber auch NATO-Stacheldraht und Schildern an den Eingängen: „Vorsicht Schußwaffengebrauch!“ Lautstark drücken Wehrdienstgegner ihr Missfallen aus. Unter den Zuschauern auf der Stadiontribüne befindet sich auch Anke Hennig, die Freundin des Wachmanns Felipe Gerlach, eine arbeitslose Lehramtskandidatin mit 1,3-Examen, die seit kurzem im Stadtarchiv Unterschlupf gefunden hat und dort die Lokalpresse auswertet. Und während sie beobachtet, wie Rekruten, darunter ihr Bruder, feierlich geloben, ihr Vaterland zu verteidigen, forsche Feldjäger furchtlose Demonstranten wie Hasen jagen, fanatisierte Zuschauer „Aufhängen!“ und „Vergasen!“ schreien, da fällt ihr, bei so viel Stillgestanden und Augen-gerade-aus, nur noch die Liedzeile ein: „Soldaten sehn sich alle gleich, lebendig oder als Leich“.
Zu ebendieser Zeit versucht der agile Steuerberater Kurt Ellerbrock in seinem Büro in der City einen unter „Abschreibungsbeschwerden“ leidenden Arzt für ein beiderseits lukratives Abschreibungsgeschäft zu gewinnen: Er wird ihm in Südamerika Rinder und Land, von dem zuvor Eingeborene vertrieben wurden, verkaufen, eine renditensichere Geldanlage, denn Berater und Beratener wissen, was sie aneinander haben, schließlich zahlt man „auch Beiträge für die gleiche Partei“.
Zu diesen drei simultan verlaufenden Handlungssträngen tritt ein weiterer hinzu: Während Felipe Gerlach seinen Rundgang macht, seine Freundin der heftig umstrittenen Vereidigung ihres Bruders beiwohnt und ein zweifelhafter Steuerberater „indianerfreies“ Land verkauft, bereiten sich „Turnschuhgenossen“ einer Lateinamerikagruppe auf den für diese Nacht geplanten Einbruch im Büro des Steuerberaters vor – sie wollen Akten an sich bringen, aus denen sich die Machenschaften des „Steuerschwindlers“ und „Abschreibungsfürsten“ hieb- und stichfest beweisen lassen. Felipe, den Asylanten und Exil-Chilenen, haben sie eingeweiht: „Wenn du deine Runde machst und siehst was Verdächtiges, dann weißt du Bescheid… schlag bloß keinen Alarm.“
F.C. Delius läßt diese Handlungsstränge in der Art filmischer Schnitt-Technik, wie wir sie aus Dos Passos‘ Manhattan Transfer, Feuchtwangers Erfolg und Koeppens Tauben im Gras kennen, simultan ablaufen; sie sind dabei mehr oder minder gebunden an den vierzigjährigen Wachmann Felipe Gerlach, die Hauptfigur des Romans. Eine so kühne wie klare Konstruktion: Sieben Stunden lang läuft Leo acht um den Adenauerplatz im Stadtzentrum; er kontrolliert Geschäfte und Büros und meldet sich jeweils bei seinem Arbeitgeber per Sprechfunk – sieben Stunden oder 35 Kilometer Wegs, in denen er wahrnimmt und beobachtet, mit offenen Augen träumt, nachdenkt und sich erinnert. Und der Leser ist Zeuge dieser in Kopf, Herz und Füßen ablaufenden Vorgänge und Prozesse.
Delius weitet wie schon in seinem ersten Roman Ein Held der inneren Sicherheit das Individuelle ins Allgemeine, private Perspektive zum politischen Panoramablick. Delius zeigt in seinem Roman Adenauerplatz die politische Wetterlage an: das Tief in Sachen politisch-intellektueller Moral, die Nebelbänke in den Niederungen, die sich vor der Utopie auftürmen. Der Blick geht ins Trübe.
Felipes Gedanken wandern in dieser Septembernacht zurück zu seiner Mutter, die gerade in Chile gestorben ist. Felipes chilenische Vorfahren, die Ende des letzten Jahrhunderts aus dem Hessischen ausgewandert sind, gehören zur Oberschicht des Landes, zum „gut organisierten deutschen Filz“, der „in jeder Torte“ die Finger hat, in „Landwirtschaft, Handel und Industrie“. Felipe aber enttäuscht die reichen, mächtigen Verwandten: Statt das Ingenieurbüro seines erfolgreichen Vaters zu übernehmen und Brücken zu bauen, studiert er Landwirtschaft und stellt sich der neuen Regierung Allende zur Verfügung. Als die rechtmäßige sozialistische Regierung mit CIA-Dollars gestürzt wird, entkommt Felipe nur mit Glück den Mordkommandos der neuen Militärjunta, noch bis in seine Alpträume hinein verfolgen ihn seither die Todesschüsse.
Der politische Flüchtling aus der Dritten Welt wird in Deutschland freundlich aufgenommen – zu einer Zeit, als man zwischen Flensburg und Freiburg noch mehr Demokratie wagen will. Felipe, „einer der Zuckerfachleute Westeuropas“(?), begehrter Kongreßredner, spürt dann am eigenen Leib, wie sich die allgemeine Wirtschaftskrise bald auswächst zu politischer Restauration. Der arbeitslose Akademiker gerät ins Niemandsland und auf die sich füllenden Flure des sozialen Netzes.
Das nun unfreundliche Deutschland ist ebenso wenig das Land seiner Wahl wie das undemokratische Chile. Was auch immer sie trennt, in einem freilich sind sie sich ähnlich: in der „Raffgier“. „Die einmal oben sind, überstehen jeden Skandal, wo alle käuflich sind, weiß keiner mehr, was ein Skandal ist, wo die Bestechlichkeit anfängt und wo sie aufhört, weil alles gegründet ist auf Geldgewinn.“ Die Bundesrepublik, ein Land, wo Geld Gesetze und Geschichte macht und wo „schon die laufenden Katastrophen nicht mehr nachhaltig schrecken, weil die Leute längst an sie gewöhnt sind.“
Während Wachmann Leo acht 40 000mal Fuß vor Fuß setzt und nur unter Skrupeln seine Pflicht tut, das heißt, für Ruhe und Ordnung sorgt, schließen die letzten Lokale, leeren sich die Straßen. Ab und zu eine Abwechslung: ein kurzer Aufmunterungsbesuch seiner Freundin, der zu Fuß vorbeihastende Steuerberater und der mit Blaulicht vorbeijagende Minister. Dann ein Fehlalarm im Juweliergeschäft, plötzlich eine Schlägerei, die deutsche Jugendliche gegen türkische Jugendliche, die nichts als telefonieren wollten, aus heiterem Himmel vom Zaune brechen. Auf einmal auch – Zufälle einer Nacht – ein US-Panzer, der sich an einer Hausfront festgeklemmt hat, weil ein betrunkener Soldat unter zuviel Liebeskummer leidet. Es sind diese kleinen Nebendinge, die in diesem Roman oft den größten Eindruck hinterlassen. Nicht die Idee und der Bauplan – das simultane Erzählen, Rückblenden, Assoziationen, eine erotische Phantasmagorie im Rhöndorfer Adenauerhaus – bereiten bei der Lektüre dieses Romans Schwierigkeiten, sondern ihre Ausführung. Delius überlädt seine Figur, statt auszusparen und durch stärkeres perspektivisches Erzählen Distanz herzustellen. Auch die Sprache wird nicht so innovativ gehandhabt wie in Ein Held der inneren Sicherheit. F.C. Delius erzählt in seinem Roman Adenauerplatz aus dem Blick eines Exil-Chilenen von einem Land, dessen politische Moral und Kultur schwer angeschlagen sind und in dem, wenn die Nacht des Wachmanns Felipe vorüber ist, vorerst auch das Licht des Tages keine Besserung bringt.
(Stephan Reinhardt, Frankfurter Rundschau, 05.01.1985)
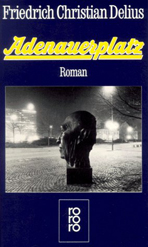 Adenauerplatz
Adenauerplatz